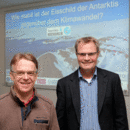Katja Knoche
E-Mail:
knoche@hdw.uni-siegen.de
Tel.: +49 (0)271 / 740 - 2513
Villa Sauer
Obergraben 23
57072 Siegen
Raum: 001
Karin Gipperich
E-Mail:
karin.gipperich@uni-siegen.de
Tel.: +49 (0)271 /740 - 2689
Villa Sauer
Obergraben 23
57072 Siegen
Raum: 003
Die Vereisungsgeschichte der Antarktis ist sehr kompliziert
Wissenschaft um 12: Der Geologe Prof. Martin Melles berichtete über Forschungsexpedition zur Schließung von Wissenslücken
Die Antarktis ist mit einer Fläche von 14.200.00 km2 rund 40 Prozent größer als Europa. Die Temperatur in der Antarktis bewegt sich zwischen - 5 und – 70 °C. Erhebungen erreichen eine Höhe von bis zu 4000 m. Bei der Antarktis handelt es sich um eine Kältewüste mit 50 – 300 mm Niederschlag im Jahr. Für das Weltklima hat die Antarktis ganz besondere Bedeutung. 90 Prozent der Eisflächen sind auf Grönland und der Antarktis zu finden. Die Gletscher der Welt umfassen insgesamt nur etwa 1 Prozent der weltweiten Eisflächen. „Wie stabil ist der Eisschild der Antarktis gegenüber dem Klimawandel?“ lautete das Thema des Geologen Prof. Dr. Martin Melles (Universität zu Köln) im Rahmen der Weihnachtslesung „Wissenschaft um 12“.
Rund 80 Gäste aus nah und fern lauschten dem Vortrag, dem sich etliche Fragen anschlossen. Prof. Melles erläuterte, dass – sollte das Eis der Antarktis schmelzen – der Meeresspiegel um bis zu 63 m ansteigen würde. Die Stadt Siegen bekäme dann Strandlage, die Stadt Köln würde unter Wasser liegen. Melles: „Die Welt würde sich massiv verändern.“ Das Eis reagiere allerdings sehr träge. Zum Ende dieses Jahrhunderts sei ein Anstieg des Meeresspiegels um mehr als 20 cm möglich. Bei einem Anstieg des Meeresspiegels um einen Meter müssten etwa 630 Millionen Menschen ihre angestammte Heimat verlassen.
Seit 1880 wird die Lufttemperatur kontinuierlich aufgezeichnet. Seit den 1980er Jahren steigt diese stetig an mit der Auswirkung, dass die Gletscher schwinden. Auch auf Grönland verstärken sich die Schmelzprozesse. Die Temperaturen in der Antarktis liegen weiterhin im Minusbereich. Die Lufttemperatur kann deshalb nicht dafür verantwortlich sein, dass in bestimmten Bereichen das Eis schmilzt. In anderen Bereichen nimmt das Eis zu. Grund für den Schmelzprozess ist wahrscheinlich das zirkumpolare Tiefenwasser, das das Schelfeis (große Eisplatte, die auf dem Meer schwimmt) tauen lässt. Das zirkumpolare Tiefenwasser ist einer von drei Hauptströmen, die im Südpolarmeer um die Antarktis auftreten. Als Ausgleich für das antarktische Bodenwasser und das antarktische Oberflächenwasser, die beide (kaltes) Wasser aus dem Bereich der Antarktis hinausführen, besteht das zirkumpolare Tiefenwasser aus wärmerem Wasser, das aus den das Südpolarmeer umgebenden Ozeanen – insbesondere dem Nordatlantik – in Richtung Antarktis fließt. Melles: „Wir wissen noch nicht ganz genau, warum das Eis schmilzt oder wächst.“
Ein Blick auf die Erdgeschichte zeigt, dass sich die Erde in den zurückliegenden 4,6 Milliarden Jahren stets im Wandel befand. Über lange Zeit hinweg war die CO2-Konzentration derart hoch, dass Leben unmöglich war. Melles: „Wir leben heute eigentlich in einem Eishaus, das durch uns Menschen verändert wird.“ Will heißen: Die Erde befindet sich aktuell in einer beginnenden Kaltzeit. Mit Blick auf den Klimawandel könnte diese Entwicklung dem Leben auf der Erde zugutekommen. Melles: „Problematisch könnte aber das Tempo der Erwärmung sein.“ Insgesamt ist die Vereisungsgeschichte der Antarktis sehr kompliziert.
Um genauere Erkenntnisse zu gewinnen brach ein sechsköpfiges Forscherteam – darunter Prof. Melles – im Rahmen des Projektes „East Antartic Ice Sheet Instability“ Ende 2023 mit dem Forschungsschiff „Polarstern“ in die Antarktis auf. Vom 17. Dezember 2023 bis zum 5. Januar 2024 nahmen die Wissenschaftler rund 100 Meter Sedimentproben am Ellis Fjord. Dabei gab es einen Überraschungsfund: aus 46 Meter Tiefe wurde über 50.000 Jahre altes Moos gefunden. Das legt die Schlussfolgerung nahe, dass diese Region einmal eisfrei gewesen sein muss.
Drei Schlussfolgerungen gab der Wissenschaftler dem Auditorium mit auf den Weg:
- Der antarktische Eisschild ist eine wichtige Komponente des globalen Klimasystems
- Kenntnisse der Geschichte des Eisschilds helfen, zukünftige Entwicklungen besser zu verstehen
- In eisfreien Landgebieten der Antarktis lassen sich kleinräumige Änderungen der Eisbedeckung rekonstruieren
Moderiert wurde die Veranstaltung von Geomathematiker Prof. Dr. Volker Michel (Universität Siegen).