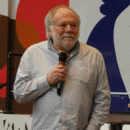Katja Knoche
E-Mail:
knoche@hdw.uni-siegen.de
Tel.: +49 (0)271 / 740 - 2513
Villa Sauer
Obergraben 23
57072 Siegen
Raum: 001
Karin Gipperich
E-Mail:
karin.gipperich@uni-siegen.de
Tel.: +49 (0)271 /740 - 2689
Villa Sauer
Obergraben 23
57072 Siegen
Raum: 003
„Ein Vorbild für uns alle“
Der Autor Reiner Engelmann las an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule aus seinem Jugendbuch „Der Fotograf von Auschwitz“
Wer erinnert an die Gräueltaten der Nationalsozialisten, wenn die Zeitzeugen immer weniger werden? Es sind die Aufzeichnungen der Lebensgeschichten und Erinnerungen der Opfer und manchmal auch die der Täter. Dazu gehört Reiner Engelmanns Jugendbuch „Der Fotograf von Auschwitz“. Der Autor aus dem Hunsrück reiste ins Siegerland, um die Vita des polnischen Fotografen Wilhelm Brasse, der als „Fotograf von Auschwitz“ bekannt wurde, an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule vorzustellen und mit rund 250 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 10 und 11 ins Gespräch zu kommen. Eingeladen worden war Engelmann vom Haus der Wissenschaft der Universität Siegen. Finanziert wurde die Lesung im Rahmen des Formats YoungPoetry von der Dieter-und-Christa-Lange-Stiftung. Die Literaturwissenschaftlerin Dr. Jana Mikota stellte den Autor vor: „Mit dem, was er macht, ist er ein Vorbild für uns alle.“
Wilhelm Brasse wurde im Dezember 1917 im seinerzeitigen Saybusch, dem heutigen Zywiec, in Schlesien geboren. Seit 1935 arbeitete er als Berufsfotograf und fertigte im entfernten Fotostudio seines Onkel Portraits und Passfotos. Als junger Mann, so Engelmann, konnte Brasse durchaus als „Lebemann“ bezeichnet werden, der gerne feierte, tanzte und auch die Mädels mochte. Nach dem Überfall Deutschlands auf Polen wollte sich Brasse in seiner Heimatstadt zur polnischen Armee melden. Zywiec war bei seinem Eintreffen aber bereits besetzt. Trotz seiner Zweisprachigkeit - er beherrschte die polnische und die deutsche Sprache – lehnte er es ab, als Deutscher anerkannt zu werden. Gemeinsam mit Freunden brach er im März 1940 auf, um sich in Frankreich dem polnischen Widerstand anzuschließen. Kurz vor der Grenze wurde die Gruppe verhaftet.
Brasse wurde gemeinsam mit 25 Menschen in eine winzige Zelle gesperrt. Viele Gefangene überlebten bereits diese erste Station als Häftlinge nicht. Engelmann: „Es war reines Glück, diese vier Monate zu überleben.“ Brasse wurde im Sommer 1940 über Tarnow nach Auschwitz transportiert. Das Vernichtungslager befand sich im Aufbau. Brasse erhielt die Häftlingsnummer 3444 eintätowiert, die bis zur Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen – seiner letzten Häftlingsstation – im Jahr 1945 durch die US-Armee seinen persönlichen Namen in der Anrede ersetzte.
In Auschwitz war Brasse zuerst im Straßenbau eingesetzt, dann als Leichenträger, in der Kartoffelschälerei und schließlich als Lagerfotograf. Als Fotograf war er sogenannter Funktionshäftling. Dieser Status ging mit besseren Lebensbedingungen und auch Überlebenschancen einher. Das unendliche Leid und zum großen Teil qualvolle Sterben der unzähligen Mithäftlinge fand Darstellung in Engelmanns Buch, das auf Gesprächen mit Wilhelm Brasse basiert. Tausende Häftlinge fotografierte Brasse. Er sorgte dafür, dass diese Fotografien nicht der von den Nazis angeordneten Vernichtung anheimfielen, sondern bis heute als Zeitzeugnisse und zur Erinnerung an die Ermordeten dienen.
In der Aula der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule herrschte über zwei Schulstunden hinweg Ruhe. Gebannt – wenn nicht gar sprachlos – lauschten die Schülerinnen und Schüler den Ausführungen des Autors. Die zweiten 90 Minuten standen für Fragen und Diskussion zur Verfügung. Die jungen Leute wollten vieles wissen. Die Fragen gingen nicht aus: Wie geht man mit Holocaust-Leugnern um? Hatten die Lagerbediensteten Freude daran, Menschen zu quälen, zu misshandeln und zu ermorden? Wurden die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und bestraft? Zeigten sie Unrechtsbewusstsein? Kann so etwas wie die Nazi-Diktatur nochmals passieren? Wie kann man vorbeugen?
Drei Stunden vergingen schnell. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich im Unterricht auf Lesung und Diskussion vorbereitet. Die Erzählung Reiner Engelmanns über das mörderische und menschenverachtende Geschehen in Auschwitz und anderen Vernichtungslagern während des Nazi-Terrors in Europa bewegte ungeachtet des Vorwissens tief.
(c) kk